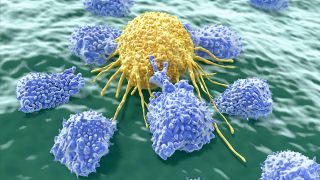Interview | Folgen der Krebstherapie - Geheilt heißt nicht gesund
Rund 500.000 Menschen erkranken hierzulande jedes Jahr an Krebs. Für viele Patienten ist das heute kein Todesurteil mehr – dank OP, Chemo- oder Strahlentherapie. Doch was die Heilung von Krebs bedeutet, kann Jahre später Folgen für die Gesundheit haben. Auch deshalb widmen sich Experten immer mehr den frühzeitigen Begleittherapien.
Herr Prof. Riess, Krebspatienten werden heute älter, viele Krebserkrankungen sind immer besser heilbar. Hat da das Thema Folgeerkrankung aus Ihrer Sicht an Bedeutung zugenommen?
Ja, eindeutig und zwar schon lange. Das Thema beschäftigt uns schon seit den 70er Jahren sehr. Natürlich muss man immer abwägen: Wenn man Langzeitüberleben erreichen kann – und zum Glück gibt’s das ja bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen – dann ist es natürlich wichtiger, den Patienten nicht an den Tod zu verlieren als eine durch die Therapie mit verursachte Nebenwirkung. Beim Thema Folgeerkrankung ist dann aber nicht nur die Erkrankung selbst wichtig, sondern auch die psychologische Wahrnehmung des Patienten (Anmerkung der Redaktion: Stichwort "Lebensqualität") – die ist immer sehr verschieden und darauf muss man eingehen. Und gerade bei den Krebserkrankungen, die man heute sehr gut heilen kann, wird es immer wichtiger sich mit den Folgeerkrankungen zu beschäftigen, anstatt "nur" damit, prozentual noch mehr Patienten heilen zu können.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Nehmen wir doch das Beispiel einer Frau mit Dickdarmkrebs – da kann ein Risiko natürlich der Verlust der Fruchtbarkeit sein. Bei einer älteren Frau wird das aber nicht im Vordergrund stehen – da kommt es darauf an, dass die Therapie für den Patienten tolerierbar ist. Und dann kommt es darauf an, dass keine Folgeschäden entstehen. Durch eine recht einfache medikamentöse Nachbehandlung nach der OP kann man die Heilungsrate signifikant und klinisch relevant verbessern. Es gibt seit Jahren ein zweites, zusätzlich wirksames Medikament, von dem man weiß: Wenn man es dazu nimmt, kann es Nervenschäden verursachen, wenn die Gesamtdosis zu hoch wird. Darüber muss man den Patienten aufklären und dann eine engmaschige Befragung durchführen – den Patienten also eng mit einbeziehen, weil wir auf die Aussagen des Patienten angewiesen sind – man kann das nicht einfach messen. Wenn man mit dem Medikament rechtzeitig aufhört, kann man das Auftreten einer sonst möglichen dauerhaften Gefühlsstörung vermeiden.
Andere häufige Nebenwirkungen liegen in dem Bereich, den wir mit Toxizität bezeichnen, also die Wirkung der Therapie tritt an anderen Zellen auf, als an den von Krebs befallenen. Konkret können das zum Beispiel sein: Übelkeit, Fieber, in schlimmeren Fällen eine Lungenentzündung oder eine andere Infektion. Das Blutbild verändert sich, die Zahl der Blutplättchen kann stark absinken und eine Blutungsneigung verursachen usw. Das sind aber ganz andere Begleit- oder Folgewirkungen als die im Fall der möglichen Nervenschädigung – weil sie reversibel sind. Außerdem kann man – und das macht man natürlich auch – z.B. bei Übelkeit schon während der Krebstherapie auch vorbeugend oder begleitend etwas tun.
Aus Ihrer Erfahrung heraus: Ist der Gedanke an Folgeerkrankungen denn bei vielen Menschen, die gegen Krebs kämpfen ein Thema? Oder spielt das erst einmal keine entscheidende Rolle im Bewusstsein der Patienten?
Jeder Mensch, der einem gegenüber sitzt, hat häufig eine ganz andere Einstellung und Auffassung, auch zu Krankheiten. Dann muss man sehr genau darauf achten als Arzt, was man dem Patienten wann zumuten kann. Insofern ist es wichtig wiederholt darüber zu sprechen. Sehr hilfreich ist auf jeden Fall nach meiner Erfahrung, diese Gespräche zusammen mit einer Vertrauensperson des Patienten zu führen. Denn diese Menschen hören ganz anders zu als der Betroffene und können sich dann auch nach Monaten oder Jahren bei bestimmten Symptomen auch daran erinnern, dass das vielleicht im Zusammenhang mit der Krebstherapie stehen könnte.
Es ist aus meiner Sicht aber auch ganz klar Aufgabe der Ärzte, auch in der Nachsorge der Patienten, die Augen und Ohren offen zu halten für Folgeschäden der Therapie und nachzufragen. Das kann ja auch z.B. das Auftreten vonpsychologischen Belastungsstörungen sein, die vermutlich gar nichts mit dem verwendeten Medikament zu tun haben. Oder es können psychologische Belastungsstörungen sein.
Auch Jahre nach der Krebstherapie können Folgeerkrankungen auftreten. Mancher (spätere) Arzt und auch der Patient bringen dann Symptome vielleicht gar nicht mit der Krebstherapie in Verbindung. Bei Kindern mit Krebs wird deshalb besonders sorgfältig und langfristig dokumentiert – bei Erwachsenen nicht. Wie kann man verhindern, dass ein möglicher Zusammenhang später vergessen wird?
Natürlich ist das bei Kindern besonders wichtig – nicht nur weil bei Kindern nach Unfällen Krebs die häufigste Todesursache ist, sondern auch, weil das Menschen sind, die 70 oder 80 Jahre dann hoffentlich nach der Behandlung weiterleben. Bei manchen Therapien kann z.B. nach 15 oder 20 Jahren noch eine Herzschwäche auftreten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in der jetzigen Versorgungssituation das Problem später beispielsweise vom Kardiologen erkannt und mit der Therapie in der Kindheit in Verbindung gebracht wird. Ich glaube aber auch, dass wir noch lange nicht vollständig in der Lage sind, sehr seltene und späte Folgestörungen mit einer Krebstherapie in Zusammenhang zu bringen, besonders bei seltenen Krebserkrankungen bzw. Behandlungsmethoden. Da fehlen uns die statistischen Zusammenhänge.
Aber: Es ist eine gute Tradition – und ich hoffe, dass die nie verloren geht – dass der Arzt stets auch die wichtigen Fragen stellt, auch nach Vorerkrankungen und -behandlungen. Und dass z.B. der Lungenfacharzt nicht nur nach Lungenerkrankungen fragt. Damit hier ein guter Informationsaustausch stattfinden kann, rate ich jedem Krebspatienten, dass er eine Art eigene Krankenakte führt. Nicht mit jeder Erkältung, aber mit Arztbriefen und Dokumenten über Operationen und darüber wie und wo – also die Institution – die Therapie gemacht wurde. Denn nach zehn Jahren weiß das der Patient oft nicht mehr so genau und für einen Kollegen, der den Patienten zum ersten Mal sieht, ist es sonst unter Umständen schwer, noch an diese Unterlagen heran zu kommen.
Herr Prof. Riess, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Lucia Hennerici