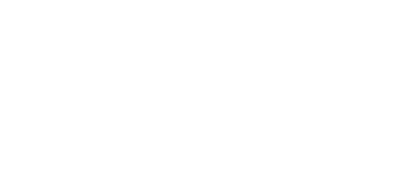Interview - Der Ring des Nibelungen – Respekt ohne Ehrfurcht
Ein Gespräch mit der Autorin/Regisseurin Regine Ahrem

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang arbeitete Richard Wagner an seinem vierteiligen "Bühnenfestspiel", wie er es nannte. Mit einer 16-stündigen Aufführungsdauer und 35 Solisten sowie über 100 Musikern gilt "Der Ring" als das umfangreichste Bühnenkunstwerk der Musikgeschichte. Was kann uns heute noch an dem Stoff interessieren?
Tatsächlich ist das Ganze ein Fantasy-Stoff reinsten Wassers. Bei der Bearbeitung war ich verblüfft über die vielen Parallelen zwischen "Der Herr der Ringe" und „Der Ring des Nibelungen“. Wobei sich natürlich Tolkien kräftig bei Wagner bedient hat. Aber auch wenn das Werk von einer mythischen Welt mit Zwergen, Riesen, Halbgöttern und Göttern erzählt: Mühelos lässt sich die Grundkonstellation der Geschichte auf die Verwerfungen heutiger Gesellschaften übertragen, wovon zahllose - erfinderische, umstürzlerische, illusionistische - Neuinterpretationen zeugen.
Was es aber so noch nie gegeben hat, ist ein Hörspiel.
Ja - und dafür haben ich die ganze Geschichte auf der Grundlage des Librettos erzählt, ohne, dass auch nur eine einzige Note gesungen wird. Dieses Libretto nun besteht aus einer Kunstsprache, die in Stabreimversen gehalten ist und aus Hunderten von historisierenden oder schlicht frei erfundenen Wortschöpfungen besteht. Hier bedurfte es einer quasi kompletten Neuübersetzung, die das wagnersche Idiom in ein zeitgemäßes Hochdeutsch überträgt
Ihre Bearbeitung kommt auf geradezu schlanke 6 Stunden, wie sind Sie da vorgegangen?
Es war mir wichtig, die Vorlage ernst zu nehmen, ohne sie ehrfürchtig zu duplizieren. Das hatte auch Konsequenzen auf den Umfang des Materials. In der Oper besteht ein Großteil der Szenen aus Redundanzen, in denen einmal Geschehenes noch und noch mal erzählt wird. Für die Dramaturgie der Oper mag das sinnvoll sein, für das Hörspiel aber habe ich mich für einen stringenten und spannenden Erzählverlauf entschieden. Dabei herausgekommen ist ein fantastischer Stoff mit faszinierenden Charakteren.
Wie sind sie mit der Musik umgegangen?
Ich hatte drei Menschen an meiner Seite, ohne die diese Arbeit nicht denkbar gewesen wäre: So kam die Idee zu dem Podcast überhaupt von dem großen Wagner-Kenner Samir Nasr. Dann war da der Komponist Felix Raffel, der - ausgehend von den wagnerschen Leitmotiven - zu einer eigenständigen Musiksprache gefunden hat. Und nicht zuletzt mein Tonmeister und Co-Regisseur Peter Avar, der das Wunderwerk vollzogen hat, diese Neukompositionen mit der Originalmusik zu verschmelzen.
Eigentlich ist der Ring ja auch ein großes Männerspektakel. Bei dieser Bearbeitung hatte ich das Gefühl, dass aber letztlich die Frauen alles in der Hand haben.
Ja, bei Wagner ist das aber schon angelegt. Das große Thema im "Ring des Nibelungen" ist ja der ewige Widerstreit von Macht und Liebe, wobei die Macht mit Besitz und Gier und die Liebe sowohl mit der Natur als auch mit der Idee der Freiheit untrennbar verbunden ist. Diese beiden Antipoden werden jeweils von Männern bzw. Frauen repräsentiert. Paradigmatisch in diesem Sinne ruft Erda Wotan in ihrer letzten Begegnung zu: "Ich habe genug von dir und deinen Männertaten". Diese inhärent angelegte, aber nicht ausformulierte Kraft der Frauen wurde für die Hörspielbearbeitung herausgearbeitet und verstärkt. Erda, die Figur der Erdmutter, ist das utopische Moment im "Ring". Sie steht für eine Befreiungsbotschaft, dass es einen Weg gibt zurück in den natürlichen Unschuldszustand der Dinge. Die erlösende Welttat bleibt dann Brünhilde vorbehalten. Sie vollzieht die finale Wiedergutmachung, die das Ungleichgewicht der Welt wieder ins Gleichgewicht bringt.