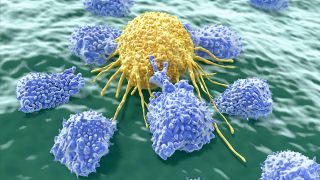Interview | Chemotherapie heute - Keine Angst vor der Chemotherapie
Die Behandlung mit Zellgiften, so genannten Zytostatika, ist fester Bestandteil der Behandlung von Krebspatienten. Bei rund 80 Prozent von ihnen kommt die Chemotherapie mindestens einmal während der Krebstherapie zum Einsatz. Vorbehalte oder gar Ängste bestehen vor allem wegen der Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Haarausfall und Müdigkeit. Doch inzwischen hat sich vieles getan. Nebenwirkungen können besser behandelt und Zytostatika gezielter eingesetzt werden.
Warum niemand mehr Angst haben muss vor einer Chemotherapie, darüber sprach rbb Praxis mit Prof. Diana Lüftner, Oberärztin an der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie der Charité am Campus Benjamin Franklin in Berlin.
Was leistet die Chemotherapie, was andere Krebstherapien nicht leisten können?
Das Wirkprinzip der Zytostatika ist, dass sie die Teilung von Zellen verhindern und Zellen, die sich nicht teilen können, gehen kaputt. Die Chemotherapie wird systemisch verabreicht, das heißt in den gesamten Körper. Dadurch werden auch kleinste Krebszellen "erwischt", aus denen erst später Metastasen entstehen würden. Die Zytostatika wirken vor allem auf Zellen, die sich schnell teilen. Das sind zum einen Krebszellen, aber auch gesunde Zellen wie Haarwurzelzellen und Zellen der Mund- und Darmschleimhaut. Deshalb entstehen Nebenwirkungen wie Haarausfall, Entzündungen der Mundschleimhaut und Durchfall. Die Chemotherapie ist vor allem noch bei den Krebserkrankungen von Bedeutung, bei denen eine sogenannte "gezielte Tumortherapie" nicht möglich ist. Das sind die Erkrankungen, bei denen die Krebszellen kein spezifisches Eiweiß tragen, das als "Andockpunkt" dienen kann.
Wie gut können diese Nebenwirkungen inzwischen behandelt werden?
Wir können die Nebenwirkungen der Chemotherapie inzwischen recht gut behandeln. Hinzu kommt, dass die unterstützende Therapie inzwischen dahingehend weiterentwickelt wurde, dass etwa 90 Prozent der Patienten mit Übelkeit und Erbrechen kaum noch zu tun haben. Was die gerade von Frauen sehr gefürchtet Nebenwirkung des Haarausfalls angeht, gibt es auch da neue Entwicklungen bei den Medikamenten. Insbesondere die Taxane, Zytostatika, die häufig bei Brustkrebs eingesetzt werden, werden wir in Zukunft in Tablettenform zur Verfügung haben und in dieser Darreichungsform kommt es viel seltener zu Haarausfall. Das lässt sich dadurch erklären, dass durch die Tabletteneinnahme der Wirkstoff viel langsamer freigesetzt wird. Es kommt nicht zu so hohen Wirkspiegeln im Blut wie bei der intravenösen Gabe und das "vertragen" die Haarwurzelzellen besser.
Mit einer so genannten Kühlkappe wird ebenfalls versucht, den Haarausfall zu verhindern. Wie erfolgreich ist das?
Das "Scalp Cooling", das Herunterkühlen der Haarwurzeln durch eine Kühlkappe ist etwas, das helfen kann, aber nicht immer und nicht immer bei allen Substanzen, die eingesetzt werden. Bei den Anthrazyklinen, einer Substanzgruppe, die häufig bei Brustkrebs eingesetzt wird, bringt die Kühlkappe nicht sehr viel. Bei den so genannten Taxanen, allerdings schon. Davon muss man den Einsatz der Kühlkappe abhängig machen. Hinzu kommt, dass das "Scalp Cooling" eine sehr unangenehme Prozedur ist. Man muss sich das so vorstellen, als ob man den Kopf in den Schnee steckt und ihn dort lange Zeit drin lässt. Nicht alle Patientinnen halten das durch und manche akzeptieren dann am Schluss lieber den Haarausfall.
Es wird viel von der individualisierten Krebstherapie gesprochen. Wie individuell ist die Chemotherapie?
Es gibt den Ansatz der so genannten Antikörper-Konjugat-Therapie. Dabei macht man sich die Oberflächeneigenschaft der Tumorzelle zu Nutze, die ganz exklusiv ist. Passend zu dieser Oberflächenstruktur wird dann ein Antikörper "gebaut", der wie eine Art "Rucksack" das Chemotherapeutikum ganz gezielt zur Krebszelle bringt. Das bedeutet, dass das Zytostatikum nur an der Krebszelle wirkt und nicht mehr an den gesunden Körperzellen, was die Nebenwirkungen deutlich reduziert. Durch diese gezielte Therapie kann man die Dosis der Medikamente auch erhöhen, weil die restlichen Körperzellen ja außen vor bleiben. Diese Antikörper-Konjugat-Therapie wird schon eingesetzt bei bestimmten Lymphom-Erkrankungen, bei Brustkrebs und sie wird gerade auch für viele andere Krebserkrankungen weiterentwickelt.
Es gibt inzwischen Tests, die zeigen, ob eine Chemotherapie überhaupt notwendig und sinnvoll ist. Welche Rolle spielen diese Tests inzwischen?
Diese Tests spielen vor allem bei Brustkrebs eine Rolle und inzwischen auch schon in manchen Fällen von Darmkrebs. Wir können mit solchen Tests klar identifizieren, wie aggressiv eine Tumorerkrankung ist und welche Patientinnen von einer Chemotherapie profitieren. Ein bestimmter Test, der Oncotype DX, wird inzwischen auch von den Gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, so dass wir vielen Brustkrebspatientinnen eine Chemotherapie ersparen können.
Welche Rolle spielen Krebsregister beim differenzierten Einsatz von Chemotherapie?
Wir haben mittlerweile, gerade bei Brustkrebs, in Deutschland mindestens drei große Krebsregister mit vielen tausend Patientinnen. Diese großen Datenmengen ermöglichen uns, immer mehr Wissen darüber zu erlangen, welche Therapien bei welchen Erkrankungsformen in welcher Reihenfolge gut wirken. Diese Register sind allerdings freiwillig. Wünschenswert wären mehr verpflichtende Krebsregister – auch für andere Krebserkrankungen - die von der öffentlichen Hand bezahlt werden.
Inzwischen gibt es auch Möglichkeiten, Chemotherapie nicht systemisch, sondern lokal zu verabreichen. Bei welchen Krebserkrankungen spielt das eine Rolle?
In ganz bestimmten Situationen, kann man tatsächlich Chemotherapie in ein Gefäß geben, das direkt zu den Metastasen hinführt. Das ist im Fall von Lebermetastasen zum Beispiel eine bestimmte Leberarterie; das macht man aber auch schon bei Darmkrebs und beim schwarzen Hautkrebs. Diese Therapie ist allerdings immer mit einem invasiven Eingriff verbunden und muss eine klare Indikationsstellung haben. Denn dies benötigt eine Punktion im Bauchraum, weswegen das Risiko für Blutungen oder eine Infektion besteht.
Wie kann man Patienten die Angst vor der Chemotherapie nehmen?
Ich finde es ganz wichtig, dass Patientinnen und Patienten sich gut informieren. Am besten über den behandelnden Arzt, denn keine Chemotherapie ist wie die andere. Viele Betroffene sind geprägt von Erzählungen über Chemotherapie, die mit dem heutigen Stand der Medizin gar nichts mehr zu tun haben. Ganz wichtig ist auch: Wenn eine Chemotherapie mit starken Nebenwirkungen einhergeht, wird ein Arzt sie nicht fortführen. Darauf können Patienten sich wirklich verlassen.
Welche Rolle spielt psychologische Hilfestellung?
Grundsätzlich sind psychologische Faktoren beim Wirken und Nichtwirken einer Chemotherapie, auch was das Nebenwirkungsspektrum angeht, relevant. Allerdings beobachten wir, dass etwa 90 Prozent unserer Patienten keine psychologische Begleitung brauchen, weil sie das selbst gut verarbeiten können. Für die anderen zehn Prozent besteht ein gutes Angebot psychologischer Hilfen, in den Kliniken, aber auch bei Organisationen wie der Berliner Krebsgesellschaft.
Kann Sport dabei helfen, eine Chemotherapie besser zu vertragen?
Tatsächlich ist es so, dass Sport und körperliche Betätigung in jedem Kontext, der nicht übertrieben ist, sehr gewünscht ist. Die Datenlage ist da mittlerweile auch sehr gut. Menschen, die vorher Sport getrieben haben, bevor sie krank wurden, haben eine bessere Prognose und vertragen die Chemotherapie besser. Sport während der Chemotherapie zu betreiben, wirkt sich extrem gut auf die Prognose, vor allem von Brustkrebserkrankungen aus. Das heißt, man sollte eigentlich allen Patienten anbieten, unter der Therapie Sport zu betreiben. Spezielle Angebote dazu gibt es bei den Krankenkassen, die mit vielen Fitnessstudios inzwischen spezielle Verträge abgeschlossen haben.
Vielen Dank für das Gespräch, Prof. Diana Lüftner.
Das Interview führte Ursula Stamm.