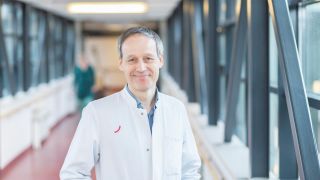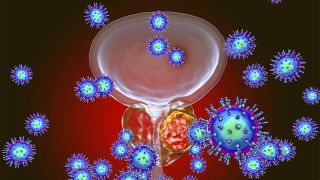Von Abwarten bis OP - Therapien bei Prostatakrebs
Prostatakrebs ist der häufigste Krebs bei Männern. Welche Therapien helfen, warum Abwarten oft hilft und wie die Heilungschancen stehen, lesen Sie hier.
Die meisten bemerken ihn gar nicht, und doch ist er da: An keiner Krebsart erkranken Männer so häufig wie am Prostatakrebs. Etwa jede vierte Krebsdiagnose betrifft bei ihnen die Vorsteherdrüse. Jährlich bekommen in Deutschland etwa 60.000 Männer diesen Befund. Doch während sich die Diskussion häufig darum dreht, ob die Früherkennungsuntersuchung mit Hilfe des PSA-Tests zu empfehlen ist oder nicht, soll es hier darum gehen, wie Prostatakrebs behandelt wird. Denn da gibt es einige Besonderheiten.
Ungewöhnlich: einfach abwarten
Für viele wird es absurd klingen: In manchen Fällen wird Prostatakrebs gar nicht therapiert – zumindest vorerst. Tumore der Vorsteherdrüse wachsen oft relativ langsam. So langsam, dass Ärzte den Patienten unter bestimmten Voraussetzungen raten, den Krebs erst einmal weiter zu beobachten, anstatt gleich zu behandeln. Dieses Konzept nennt sich "Active Surveillance", also aktive Überwachung. "Man verschiebt den Zeitpunkt der aktiven Therapie", sagt Steffen Weikert, Chefarzt der Urologie am Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum. Die Patienten müssen regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen gehen. "Erst wenn der Tumor aggressiver oder größer wird, behandelt man ihn", sagt Weikert. In vielen Fällen sei das aber gar nicht nötig, weil der Krebs nicht fortschreite. Und man kann so mögliche Komplikationen einer Operation umgehen (siehe unten.)
Anders verhält es sich bei einer weiteren Abwarte-Strategie. Sie nennt sich "Watchful Waiting", was übersetzt so viel wie "aufmerksames Warten" bedeutet. Sie kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn der Patient aufgrund von weiteren schweren Erkrankungen eine eingeschränkte Lebenserwartung hat und nicht mehr von einer aktiven Therapie profitieren würde. "Man greift nur medizinisch ein, wenn bei den Patienten Beschwerden entstehen", sagt Weikert. "Etwa wenn sie Schmerzen haben oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen auftreten."
Operation oder Bestrahlung?
Entscheiden Ärztinnen und Ärzte aber, dass es besser ist, den Krebs zu behandeln, stehen ihnen im Wesentlichen zwei Optionen zur Verfügung. Eine davon ist, die Vorsteherdrüse durch eine Operation zu entfernen. Dabei wird – je nach Tumorstadium – nicht nur die Prostata entfernt, sondern auch die umgebenden Lymphknoten. In jedem Fall müssen aber die Samenleiter durchtrennt werden, sodass Patienten nach solch einer Prostataentfernung keine Kinder mehr zeugen können. In der Praxis sei das aber fast nie ein Problem, weil die allermeisten Patienten schon älter seien und keinen Kinderwunsch mehr hätten, sagt Weikert. In der Mehrzahl der Fälle können nach der OP allerdings Erektionsstörungen auftreten. Um das zu umgehen, sei es bei vielen Patienten möglich, besonders nervenschonend zu operieren. Nach dem Eingriff ist auch dauerhafte Inkontinenz ein gefürchtetes Problem. "Dank moderner und gut standardisierter OP-Techniken und eines intensiven Reha-Programms tritt es heute aber kaum noch auf", sagt Weikert. Insgesamt spiele die Erfahrung des Operateurs aber immer noch eine große Rolle.
Die andere Möglichkeit neben der Operation ist, den Krebs von außen zu bestrahlen. Nachdem mit Hilfe moderner Bildgebung genau bestimmt wird, wo in der Prostata sich der Tumor befindet, wird der Patient entsprechend positioniert, damit die Strahlung präzise ihr Ziel erreicht. Manchmal wird die Bestrahlung mit einer Hormontherapie kombiniert. Ziel ist, die männlichen Geschlechtshormone zu blockieren, denn sie stimulieren das Krebswachstum. Außerdem wird das Tumorgewebe dadurch anfälliger für die Bestrahlung.
"Was die Heilungsrate nach fünf und zehn Jahren betrifft, schneiden Operation und Strahlentherapie ähnlich gut ab", sagt Weikert. Zwar gebe es Hinweise, dass die Operation für Patienten mit Hoch-Risiko-Tumoren besser geeignet sei. Valide Untersuchungen, die beide Methoden direkt vergleichen, gebe es hingegen nicht. Es komme immer auf den Einzelfall an, welche Methode gewählt wird, sagt Weikert. "Hat jemand schon eine vergrößerte Prostata oder Probleme beim Wasserlassen, dann profitiert er eher von einer OP, dagegen ist bei der Strahlentherapie das Inkontinenzrisiko etwas niedriger." Das müsse man alles in die Entscheidung einbeziehen.
Strahlung aus nächster Nähe
Wenn der Tumor schon in einem frühen Stadium entdeckt wird, gibt es außer der oben genannten Strategie der "Active Surveillance" noch eine weitere Möglichkeit: die Brachytherapie. Mit einer dünnen Hohlnadel bringen Mediziner dabei bestimmte Iod-Ionen (125Iod-Seeds) in die Prostata ein. Das sind kleine Strahlenquellen, die mit sehr geringer Dosis dem Tumor sozusagen aus nächster Nähe den Garaus machen sollen. Sie bleiben dauerhaft in der Vorsteherdrüse. Es handle sich um ein technisch anspruchsvolles Verfahren, sagt Weikert. "Man braucht viel Expertise, da die Seeds die ganze Prostata abdecken müssen." Die kurze Therapiedauer sei ein Vorteil für die Patienten, für aggressivere Krebsformen fehlten bisher aber zuverlässige Studien. Daher empfehle man die Brachytherapie nur für weniger aggressive Formen von Prostatakrebs.
Neue Therapie bei Metastasen in Sicht
In manchen Fällen wird der Tumor aber erst entdeckt, wenn er sich schon in andere
Körperregionen ausgebreitet, also Metastasen gebildet hat. Dann kommt meist eine Hormontherapie oder eine Kombination aus Hormon- und Chemotherapie zum Einsatz. Bleibt auch sie wirkungslos, könnte vielleicht bald eine neue Methode helfen. Bei der PSMA-Therapie (prostataspezifisches Membranantigen) wird per Infusion ein schwach radioaktiver Stoff (177Lutetium) verabreicht, der sich spezifisch an bestimmte Oberflächenstrukturen auf den Prostatakrebszellen bindet und sie so zerstören soll. In einer Studie von Wissenschaftlern der TU München sprachen bestimmte Patienten recht gut auf die PSMA-Behandlung an, das heißt, die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung verlängerte sich. Bisher ist die Therapie noch nicht zugelassen, wird aber schon angewandt, wenn keine Alternativen zur Verfügung stehen.
Insgesamt, sagt Weikert, gebe es durchaus Fortschritte bei der Behandlung des Prostatakrebs. Mit verfeinerten Methoden – etwa minimalinvasiver Chirurgie und dem Einsatz von Robotern – könne man schonender und präziser operieren als früher. "Durch neue Medikamente lässt sich das Leben vieler Patienten mit weit fortgeschrittenem Prostatakrebs außerdem deutlich verlängern." Und schließlich könne man inzwischen Patienten besser identifizieren, bei denen man erst einmal abwarten könne. Eine generelle Prognose aber könne er nicht geben: "Das kommt immer auf das Tumorstadium und den einzelnen Patienten an."
Hilft mehr Gemüse gegen den Krebs?
Und was kann man selbst gegen den Krebs tun? Experten gehen davon aus, dass Prostatakrebs zum Teil auch durch einen "westlichen Lebensstil" bedingt ist. In Nordamerika und Europa tritt er deutlich häufiger auf als etwa in Afrika oder Asien. Dafür, dass dies nicht allein auf die Gene zurückzuführen ist, spricht, dass chinesische Männer in den USA 16-mal häufiger erkranken als in China.
Trotzdem kann eine Ernährungsumstellung Männer wohl nicht vor dem Fortschreiten des Tumors bewahren. Das ist das Ergebnis einer Studie, die kürzlich im US-amerikanischen Ärzteblatt JAMA veröffentlicht wurde. Untersucht wurden fast 500 Patienten im Alter von 50 bis 80 Jahren, bei denen Prostatakrebs im Frühstadium diagnostiziert wurde. Die Hälfte von ihnen bekam über zwei Jahre eine intensive Ernährungsberatung, die dazu führte, dass sie mehr als zwei Portionen pro Tag mehr Gemüse aßen als vor der Studie. Dabei ging es unter anderem um Rosenkohl, Brokkoli, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch.
Allerdings führte die Ernährungsumstellung nicht zu einem Erfolg. In der Gruppe mit den Gemüse-Essern wuchs der Prostatakrebs in etwa bei genauso vielen wie in der Gruppe derer, die sich weiter wie bisher ernährten. Die Autoren der Studie wissen nicht, woran es lag, dass sich in dieser klinischen Studie die Ergebnisse von Beobachtungsstudien nicht bestätigten. Die Ergebnisse bedeuten jedenfalls nicht, dass eine gemüsereiche Ernährung schadet. Sie könnte beim Prostatakarzinom allerdings nicht so viel nützen, wie manche Forscher erwartet hatten.